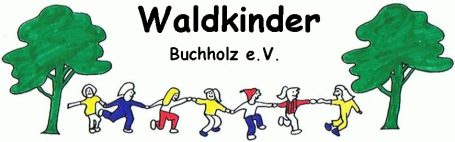Konzeption
Konzeption des Waldkindergartens Buchholz Aller
1. Wald-Kindergarten, warum?
1.1 Altersgruppe
1.2 Betreuung
1.3 Unterkunft und Lage
1.4 Tagesablauf
1.5 zusätzliche Angebote
1.6 Kleidung und Ausstattung
2. Pädagogische Arbeit im Waldkindergarten
2.1 Natur als Lern- und Erfahrungsraum
2.2 Ganzheitliches Lernen
2.3 Aufbau sozialer Kompetenzen
2.4 Selbstwertgefühl
2.5 Förderung der Sinne
Im März 2007 gründete eine Elterninitiative den Verein „Waldkinder Buchholz e.V.“, mit dem Ziel, Kinder spielerisch an die Natur heranzuführen. Dies soll geschehen in Waldspielkreisen, Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten sowie durch die Einrichtung des hier vorgestellten Waldkindergartens. Buchholz Aller ist ein kleiner Ort in der Nähe von Schwarmstedt mit einem alten Ortskern und Neubaugebieten. Im näheren Umkreis liegen Marklendorf, Essel, Bothmer, Grindau, Gilten und Schwarmstedt, die ebenfalls über Neubaugebiete verfügen. Die Betreuungssituation ist seit einigen Jahren schwierig, in Buchholz stehen im Regelkindergarten wesentlich weniger Vormittagsplätze zur Verfügung als Anfragen danach vorhanden sind. Die Gemeinde hat daher die Plätze im Waldkindergarten in die Bedarfsplanung aufgenommen und unterstützt die Initiative finanziell.
1. Wald- Kindergarten, warum?
„Seit der Gründung des ersten Waldkindergartens in Deutschland wurde aus einer hierzulande exotisch anmutenden Idee eine der innovativsten pädagogischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Vor allem durch das Engagement interessierter und mutiger Eltern und ErzieherInnen wuchs die Bewegung der Natur- und Waldkindergärten mittlerweile auf über 750 Einrichtungen. Die PISA- Studien haben die Diskussion um mehr Bildungsinhalte im Kindergarten in Gang gebracht. Viele der Kriterien, die heute zur Bildung von Kindern gefordert werden, werden im Waldkindergarten schon lange umgesetzt. Darüber hinaus wurden bereits einige Waldgruppen wissenschaftlich begleitet und auch diese Studien zeigen uns: Der Wald- und Naturkindergarten legt überdurchschnittlich gute Grundlagen für die gesamte Entwicklung des Kindes.“ ( Maria-Luise Sander, BvNW) Im Waldkindergarten werden die herkömmlichen Methoden der Kindergartenarbeit verlassen, insbesondere der räumlichen Standards und der materiellen Ausstattung. Maximal 15 Kindern stehen zwei bis drei Betreuer zur Verfügung sowie „unendlich“ viel Platz. Auf diesem Wege werden unter anderem die Probleme der enormen Lärmbelastung von Kindern und Erziehern vermieden und eine intensive Beobachtung und gezielte Förderung der einzelnen Kinder ermöglicht. Kinder lieben Bewegung und Kinder brauchen Bewegung. Intelligenz, Handlungsplan, Motorik – jegliche Entwicklung basiert auf der Erfahrung von Bewegung. Im Wald ist Bewegung eine Selbstverständlichkeit und hier kann ihr Raum gegeben werden. Unsere Kinder wachsen in einem Überfluss an (medialen) Reizen auf. Man hat längst erkannt, dass dies eine wichtige Ursache für u.a. Konzentrationsschwäche und aggressives Verhalten ist. Im Waldkindergarten ist die wichtigste pädagogische Kraft die Natur selbst. Der offene Raum, die Stille, die frei verfügbare Zeit zum Spielen und leicht nachvollziehbare, sinnhafte Regeln bilden den äußeren Rahmen, in dem die Kinder zu innerer Ruhe und emotionaler Stabilität finden können. Bastel-, Bau- und Spielmaterial bieten Wald und Wiesen in Fülle und mit der kindlichen Phantasie wird daraus ein Auto, ein Krankenwagen, eine Angel, eine Pferdeweide, Bauklötze und vieles mehr. Waldkinder sind immer beschäftigt. Sie kennen keine Langeweile, sie trainieren spielerisch Fein- und Grobmotorik und arbeiten ganz selbstständig und frustrationsfrei an ihren Defiziten. Wie alle andern Kindergartenkinder lernen aber auch sie den Umgang mit Stiften, Scheren, Klebern und Papier.
1.1 Altersgruppe
Im Wald können 15 Kinder im Alter ab 3 Jahren bis zum Schuleinstieg betreut werden. Das letzte Kindergartenjahr ist wie im Regelkindergarten beitragsfrei, es bleibt – ebenfalls wie in Regelkindergärten – lediglich eine Zuzahlung für Sonderöffnungszeiten und Verpflegung. Es ist selbstverständlich möglich, im letzten Jahr in den Regelkindergarten zu wechseln. Eine intensive Vorschularbeit in Kooperation mit dem Kindergarten Buchholz wird aber auch bei uns angeboten, sowie zahlreiche Angebote zum Kennenlernen der anderen Schulanfänger
1.2 Betreuung
Die Kinder werden täglich von zwei Fachkräften betreut. Ergänzt wird das Team regelmäßig durch einen Praktikanten. Wir werden versuchen die dreiwöchige Schließzeit in den Sommerferien im Wechsel mit dem Regelkindergarten Buchholz zu legen, um den Eltern eine durchgehende Betreuung ermöglichen zu können. Insgesamt betragen die Schließzeiten ca. 26 Tage, plus eventuell hinzukommende „Brückentage“ und Feiertage. Der Kindergarten ist von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet. Die Kernbetreuungszeit liegt zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr. 1.3 Unterkunft und Lage Im Naherholungsgebiet von Buchholz Aller nutzt der Waldkindergarten ein ca. 3000qm großes eingezäuntes waldiges Grundstück als täglichen Treffpunkt, der direkt mit Auto oder Fahrrad angefahren werden kann. Es gibt ein beheizbares Wochenendhaus mit drei Räumen, einem Bad und einer Küchenzeile. Bei großer Kälte, Sturm oder anhaltendem Regen können sich die Kinder hier aufwärmen, umziehen und aufhalten. Hier können quasi alle Angebote eines Regelkindergartens stattfinden. Es stehen Bastelmaterial, Malsachen, Bücher, Puzzle und Spiele zur Verfügung und wir freuen uns so auch einmal auf schlechteres Wetter. Auf dem Gelände ebenfalls vorhanden ist ein großer, fester Pavillon, der bei kurzen Schauern als Schutz dienen kann. Auf dem Grundstück sind Möglichkeiten zum Schaukeln, Klettern, Rutschen, Balancieren, Buddeln und für Wasserspiele geschaffen worden. Die Kinder gestalten das Grundstück täglich weiter. Das Gelände grenzt direkt an die abwechslungsreichen Allerwiesen mit einem vielfältigen Bestand an Vögeln und anderen Tieren. Ein Rudel von 5 Rehen trotzt unserem Kindergartentrubel, es können Störche, Enten, Möwen und Gänse beobachtet werden und im Herbst und Frühjahr haben wir direkten Blick auf einen gut besuchten Rastplatz der Zugvögel. Auf unserem Grundstück toben Eichhörnchen durch die Bäume und freuen sich an den Nüssen, die die Kinder ihnen ins Vogelhäuschen legen. Tritt die Aller über die Ufer, finden sich überall auf den Wiesen kleine, flache Wasserflächen, die gefahrlos und begeistert bespielt werden können. Auch die Gräben füllen sich mehrfach im Jahr. Die Aller selber wird ab und zu ebenfalls besucht, aufgrund der Strömung allerdings nur mit Sicherheitsregeln und in einem gebührenden Abstand. Zwei kleine strömungsfreie Buchten mit Flachwasser und einer faszinierenden Wasserwelt können ab und zu auch direkt erforscht werden. Der angrenzende Wald verfügt über einen vielfältigen Baumbestand. Ein großer Anteil an Kiefern bietet auch im Winter guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Im Sommer genießen wir die angenehme Kühle und die Lichtspiele. Es gibt Hügel, große Senken und unendlich viel Bau-, Bastel- und Spielmaterial.
1.4 Tagesablauf
Der Tagesablauf wird grundsätzlich mit den Kindern abgesprochen. Die Kinder werden um 8 Uhr gebracht, um 8.15 Uhr haben alle Eltern das Grundstück verlassen und wir beginnen mit einem Morgenkreis. Wir begrüßen uns mit Sing- und Bewegungskreisspielen, erzählen uns aufregendes des vergangenen Tages und besprechen, wo wir heute hingehen möchten. Die Rucksäcke werden geschultert und dann geht es in ein Waldstück – z.B. zum Krokodilsgehege oder auf den Schneckenberg – oder auf eine der Wiesen, um vielleicht zu schauen, welche Schätze der Maulwurf aus der Erde geborgen hat, ob sich die Regenwurmpopulation schon vom letzten Sammeleinsatz erholt hat oder um zur entfernten Kletterweide hinter unserer selbstgebauten Brücke zu gehen. Unterwegs finden wir ein ansprechendes, geschütztes Fleckchen für ein Frühstück, zum Ausruhen und dem Vorlesen oder Erzählen einer Geschichte. Gespielt wird immer und überall und zu entdecken und zu fragen gibt es zu- Hauff. Wie gut, dass es Bestimmungsbücher im Rucksack der Betreuer und zu Hause Internet gibt. Nach einem zweiten Frühstück, Liedern, Fingerspielen oder einer zünftigen Purzeljagd, mit Bastelmaterial, spannenden Fundstücken und wieder vielen Regenwürmern für unseren Kompost beladen, geht es zwischen 12 und 13 Uhr zurück auf das Gelände. Als hätte noch niemand Zeit zum Spielen, geschweige denn Bewegung gehabt, tobt die ganze Bande wieder los und verteilt sich auf dem Hüttengelände. Um 12.50 Uhr – und eigentlich immer zu früh - treffen wir uns zum Abschlusskreis, erzählen, was wir erlebt haben und schließen mit einem Lied.
1.5 zusätzliche Angebote
Mittwoch ist Kochtag. Das ist den Kindern wichtig und macht auch uns Spaß. Im Winter in der Hütte, im Sommer draußen, wird geschnippelt und gewogen und zusammengerührt und dekoriert. Gekocht wird dann von einer Betreuungskraft unter aktiver Hilfe einzelner. Die anderen freuen sich über andere Angebote oder endlich mal viel Zeit für das Grundstück. Ab und zu wird auch gerne einmal draußen gekocht, im Dreibein mit „Hordentopf“ und Feuerschale Am Donnerstag ist Vorschule. Und inzwischen auch Vorvorschule… denn auch die kleineren sind neugierig geworden und werden mit viel Bewegung und Spaß an Zahlen, Farben und Formen herangeführt. Wir orientieren uns am Würzburger Programm, bilden unsere Fachkräfte aber auch regelmäßig in anderen Bereichen fort. Die Vorschularbeit wird in enger Kooperation mit dem Regelkindergarten Buchholz durchgeführt. Wir besuchen uns gegenseitig und fördern das Kennenlernen der Kinder untereinander sowie der jeweils anderen Arbeitsweise. Wie in anderen Kindergärten auch, finden bei uns Projekte, Ausflüge, Schlaffeste und Feiern statt. Wir bekommen Besuch von Polizei und Feuerwehr, arbeiten mit bei Naturschutzprojekten und erkunden Alltägliches wie Einkaufen, Zug fahren oder auch das Leben auf dem Bauernhof.
1.6 Kleidung und Ausstattung
Mit der richtigen Kleidung ist das Draußensein bei (fast) jedem Wetter schön. Waldkindergarteneltern haben in Bezug auf die Bekleidung eine größere Verantwortung als im Regelkindergarten. Im Wald sind Funktion und Haltbarkeit weit wichtiger als Form, Farbe und Marke. Alle Kleidungsstücke sollten atmungsaktiv sein und keine Feuchtigkeit aufnehmen. Diese Kleidung ist oft nicht billig, man kann sie aber auch gebraucht bei Onlineversteigerungsplattformen oder auf Secondhandflohmärkten bekommen und sie wird natürlich auch im Waldkindergarten weitervererbt. Im Herbst und Winter ist die „Zwiebeltechnik“ ganz wichtig, also das Tragen mehrerer Schichten Kleidung, um die Körperwärme optimal zu halten und bei Bedarf Kleidungsstücke ablegen zu können. Fast immer ist der Morgen wesentlich kühler als der Mittag, im Frühling macht das manchmal 10°C aus. Unerlässlich ist gutes, atmungsaktives Schuhwerk. Bei Dauerregen und tollem Pfützenwetter sind natürlich auch Gummistiefel sinnvoll. Nasse oder kalte Füße können den ganzen Tag verderben. Eine Kopfbedeckung gehört das ganze Jahr zur Ausstattung - als Kälte-, Nässe-, Sonne- oder Mückenschutz. Wichtig ist außerdem ein gut sitzender, größenangepasster Kinderrucksack. Er muss über einen Verschluss in Brusthöhe verfügen, damit die Träger nicht über die Schultern rutschen können, wasserdicht und auswaschbar sein. Hinein gehören Wechselkleidung, eine kleine Sitzunterlage, ein reichhaltiges Frühstück (frische Luft macht seeeehr hungrig!), genug zu trinken und ein feuchter Waschlappen in einem geeigneten Behälter (Dose oder Plastikbeutel mit Klipp) Für unsere Neuzugänge halten wir zu diesem Thema einen sehr guten, ausführlichen Bekleidungsratgeber aus dem Waldkindergarten Friedrichsdorf e.V. bereit.
2. Pädagogische Arbeit im Waldkindergarten
2.1 Natur als Lern- und Erfahrungsraum
Naturbegegnung ist von zentraler Bedeutung für die kindliche Entwicklung. Durch den ständigen Aufenthalt in der Natur gewinnen die Kinder Einblick in die Vielfalt der Arten und Lebensformen. Der Kreislauf der Natur wird direkt wahrgenommen. Kinder lernen Zusammenhänge zwischen Klima, Jahreszeiten, pflanzlichem Wachstum und tierischem Leben erkennen. Das Verständnis für ökologische Zusammenhänge wird gefördert. Auch sich selbst ordnen die Kinder in diese größeren Zusammenhänge ein. Sie erleben sich als eingebettet und geborgen in einer höheren Ordnung. Der Wald bietet Raum für Leben, Phantasie und Rückzug sowie das Erfahren der natürlichen Elemente Luft, Erde und Wasser. Durch die persönlichen Erfahrungen und das unmittelbare Naturerlebnis kann ein positives Verhältnis zur Natur aufgebaut und ein behutsamer Umgang mit jeder Art von Leben erlernt werden. Wichtiger und tiefgreifender als konkretes Wissen über Tiere und Pflanzen sind dabei die sinnlichen Erfahrungen, die die Kinder mit den Lebewesen am Wegesrand und Wald machen. Der Wald mit seinen Geheimnissen ist als Lern- und Erfahrungsraum für Kinder geradezu unerschöpflich. Wir arbeiten im Waldkindergarten nach einem situativen Ansatz. Vereinfacht durch die kleine Gruppengröße können wir so auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Kinder eingehen, anstatt nach einem festen „Lehrplan“ vorzugehen. Die Entdeckung eines Regenwurmes kann ein ganzes Regenwurmprojekt anstoßen mit Forschungsarbeiten, Versuchen, Recherchen und mehrwöchigen Beobachtungen. Aber auch die Entwicklung der Kinder kann so optimal begleitet werden. Wir können die einzelnen Kinder intensiv beobachten und im geeigneten Moment gezielt fördernd in das Spiel einsteigen. Dem Bedürfnis der Kinder nach „echter Arbeit“ können wir in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, wie z.B. dem NABU nachgehen. Hier können wir mit unseren Kindern kleinere Umweltschutzprogramme begleiten und sinnstiftend mitarbeiten.
2.2 Ganzheitliches Lernen
„Etwas selbst gelernt zu haben, etwas selbst getan zu haben, etwas bewirkt zu haben, das ist entscheidend. Kinder können nicht belehrt werden, sie können nur selbst lernen. Dabei stehen die körperlichen Fähigkeiten in einem direkten Zusammenhang mit dem Lernvermögen.“ (Donata Eschenbroich , Jugendforscherin, im Spiegelinterview)
Die Erziehung in Waldkindergärten ist ganzheitlich orientiert. Das heißt, die Kinder werden sozial, emotional, intellektuell, schöpferisch und körperlich gefordert. Kinder erfahren ihre Welt durch vielfältige Selbstaktivität. Ihr Wissen basiert zum großen Teil auf real gemachten Erfahrungen, durch unmittelbare Begegnung mit Gegenständen, Menschen, Tieren und Situationen. Der gemeinsame liebevolle, konzentrierte Bau eines Spinnengeheges etwa, inklusive Fahne und Spinnenspielpark aus Moosen, Tannenreisig, Farnzweigen und Tannennadeln ist eine große Herausforderung an Kreativität, Handlungsplanung, soziales Miteinander, sprachliche Fähigkeiten und nicht zuletzt der Feinmotorik.
2.3 Aufbau sozialer Kompetenzen
Gemeinsames Erfahren und bewältigen von neuen Situationen lässt den Gruppenzusammenhalt wachsen und ist gleichzeitig ein Beitrag zur Stabilisierung der Ich-Stärke. Wie in jeder Kindergartengruppe lernen die Kinder des Waldkindergartens im Umgang mit Gleichaltrigen soziale Verhaltensweisen kennen. Der Gruppenzusammenhalt und die Verantwortungsübernahme für andere kann durch den Ernstcharakter im Wald sogar eine noch größere Rolle als im Regelkindergarten spielen – beispielsweise beim nur gemeinsam zu bewältigenden Bau einer Brücke oder Vergessen eines Rucksackes beim Ausgangspunkt und dem damit notwendigen Teilen der eigenen Sachen. Die Wichtigkeit der anderen Kinder als sozialer Partner nimmt zu, wenn materielle Angebote in den Hintergrund treten. Das Kind erlebt sich selbst als Teil der Gruppe und als wichtig und gebraucht mit all seinen Fähigkeiten. Im Waldkindergarten lernen die Kinder ohne vorgefertigtes Spielzeug zu spielen. Naturmaterialien bieten ungeahnte Möglichkeiten der Gestaltung und fördern dabei zugleich mit Kreativität und Phantasie die kommunikativen Fähigkeiten der Kinder, da diese sich über Funktions- und Bedeutungsinhalte verständigen und ihre Handlungsplanung aufeinander abstimmen müssen.
2.4 Selbstwertgefühl
„Kita soll nicht Lesen und Schreiben beibringen und die Schule vorwegnehmen. Ein guter Kindergarten hilft viel mehr, das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken“. (bayrisches Staatsinstitut Frühpädagogik)
Kinder entwickeln ihr Selbstwertgefühl durch die körperliche Erfahrung, ihre Umwelt gestalten und verändern zu können. Ihr Selbstbild entsteht durch die verschiedenen Aktivitäten mit all ihren Erfolgen und Misserfolgen. Mühsam aber unermüdlich wird der Kletterbaum ein ums andere Mal angegangen – und auf einmal klappt es! Und der Ameisenausgucksturm will einfach nicht stehen bleiben. Immer wieder fallen alle Steine und Rindenstücke auseinander. Jetzt mal die großen, schweren Teile nach unten, die kleineren drüber…, na bitte, ich kann das! Indem sie spielerische Leistungen vollbringen, trainieren sie ohne Erfolgsdruck von außen ihre eigenen Fähigkeiten und bauen ein stabiles Selbstwertgefühl auf. Der Wald, als offener, vielgestaltiger Erlebnisraum eröffnet diesbezüglich eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Körpererfahrung, zur Entfaltung der kindlichen Phantasie, der Kreativität und letztlich des Vertrauens auf das eigene Können.
2.5 Förderung der Sinne
Der Wald ist erfüllt mit einer Vielfalt von Reizen, die in keinem anderen Raum so vorzufinden oder nachzugestalten sind. Das Kind stellt sich unmerklich und spielerisch auf diese Sinneseindrücke ein, wird quasi nebenher in allen Sinnesbereichen gefordert und gefördert. Körper und Gehirn müssen unentwegt unterschiedliche Reize wahrnehmen, verarbeiten und sich darauf einstellen. Sicherlich ist das einer der Gründe, warum „frische Luft“ so müde macht. Da gibt es minutiöse Wechsel von Temperatur – im Schatten kühl, im Sonnenstrahl, der durch die Bäume bricht ganz warm, im Halbschatten der großen Buche wunderbar mild. Der Wind kommt als warmes, streichelndes Lüftchen, als kräftige Böe, die uns beinahe umschmeißt oder er bewegt nur ein paar Blätter sacht. Das Gehör bekommt eine Vielzahl leiser Impulse, denen nachzugehen so spannend sein kann – was hat da gerade geraschelt? Wie viele verschiedene Vogelstimmen unterscheiden wir? Schimpft der Eichelhäher? Warum rauschen die Bäume gerade so wild? Da müssen die Augen im grünen Zwielicht der dichten Bäume aus dem Blatt-, Erd-, Stock, Planzengewimmel am Boden genau den einen Hundertfüßer wieder finden, der eben aus dem Gehege ausgebrochen ist. Und was entdeckt man dabei nicht noch so alles? Immerzu gilt es sich mit unterschiedlichen Untergründen und Materialien auseinanderzusetzen. Kein Material ist genau glatt und einheitlich, der Untergrund ist niemals eben. Es gilt Grasbüschel, Stöcke, rutschige Stellen, Unterholz, weiche Blätterberge, Hügel und Senken zu überwinden und man erkennt leicht, wer nur mal zu Besuch im Wald ist. Aber wir haben ja Pflaster dabei…
©Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.